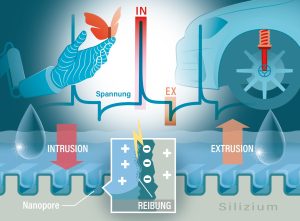Bildquelle: Pixelbuddha Studio -stock.adobe.com/TU Darmstadt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) richtet eine neue Forschungsgruppe unter Federführung der TU Darmstadt ein. In dem Vorhaben „SynDiPET“ von TU-Professorin Dr.-Ing. Bai-Xiang Xu als Sprecherin geht es um sogenannte protonenleitende Keramiken, die aufgrund ihres möglichen Einsatzes als Elektrolyte Schlüsselmaterialien für die Energiespeicherung und Brennstoffzellentechnologie sind. Die Technologie ermöglicht mit relativ geringem Energieeinsatz die Erzeugung von hochreinem, trockenem Wasserstoff, der direkt weiterverwendet werden kann. Wasserstoff gilt als einzige realistische Lösung, um erneuerbare Energie in großem Maßstab zu speichern.
Allerdings stößt bei der Gestaltung von protonenleitenden keramischen Elektrolyten das bisherige Materialdesign zunehmend an Grenzen, was eine breite Anwendung bislang einschränkt. Hier setzt die Forschungsgruppe „Synergetisches Design protonenleitender Keramiken für Energietechnologie (SynDiPET)“ an: Sie will in einer übergreifenden Betrachtung die Mikrostrukturen von Elektrolytkeramiken optimieren, insbesondere durch neuartige Sinter- und Charakterisierungstechnik. Dabei sollen auch skalenübergreifende Simulationen und Methoden des Maschinellen Lernens einbezogen werden. Weiterlesen