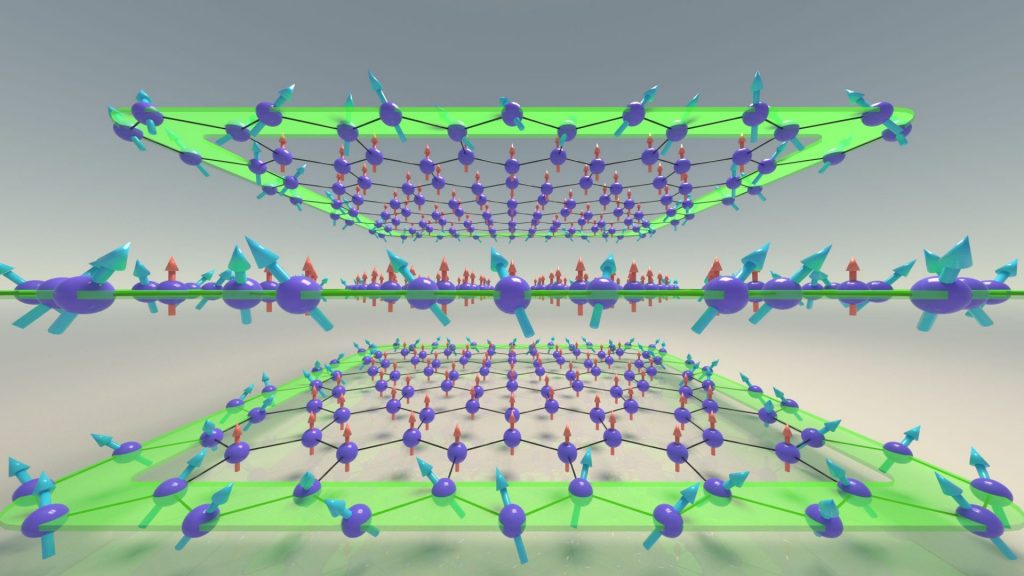Dr. Sebastian Kirmse, Dr.-Ing. in Systems Engineering, Senior Consultant im Bereich R&D Transformation
bei MHP (Quelle: MHP)
Z-Threaded Carbon Fiber Reinforced Polymer (ZT-CFRP)
Leichtere, leistungsfähigere und multifunktionale Werkstoffe sind mittlerweile in allen Branchen gefragt. Der innovative Verbundwerkstoff ZT-CFRP, der von einer Forschungsgruppe der University of South Alabama entwickelt wurde, kann die Nachteile herkömmlicher kohlenstofffaserverstärkte Polymere (CFRP) überwinden und neue Möglichkeiten in der Produktion bieten. Mithilfe von MHP soll ZT-CFRP nun marktfähig gemacht werden.
Es ist nichts Neues, dass Automobil- und Flugzeughersteller schon seit vielen Jahren den Leichtbau forcieren, um kraftstoffsparende Vehikel auf den Markt zu bringen. Dabei sollen Materialien zum Einsatz kommen, die nicht nur leicht, sondern zugleich robust sind und den Insassen damit Sicherheit bieten. Wenn sich die Materialien dann noch sehr effizient herstellen lassen ist das der Idealfall. Weiterlesen

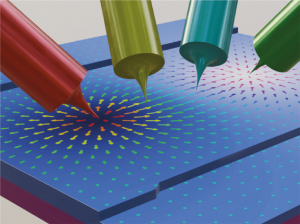

 Egal ob Blähgraphit als Flammschutzadditiv oder Spezialgraphite für Leitfähigkeitsanwendungen, Graphite der Firma LUH werden seit vielen Jahren in verschiedensten Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Bisher waren die Graphite nur in Pulverform verfügbar. Jetzt bietet die Firma LUH ihre bewährten Spezialgraphite auch als hochgefüllte Kunststoff-Compounds oder Masterbatches an.
Egal ob Blähgraphit als Flammschutzadditiv oder Spezialgraphite für Leitfähigkeitsanwendungen, Graphite der Firma LUH werden seit vielen Jahren in verschiedensten Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Bisher waren die Graphite nur in Pulverform verfügbar. Jetzt bietet die Firma LUH ihre bewährten Spezialgraphite auch als hochgefüllte Kunststoff-Compounds oder Masterbatches an.