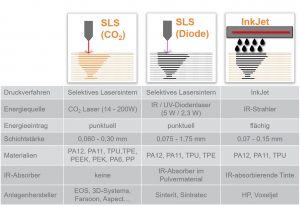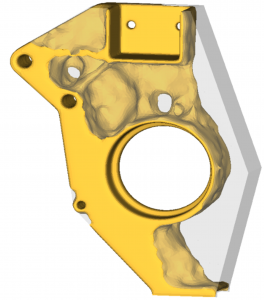Wassertropfen haften der selbstreinigenden Aluminium-Oberfläche nicht an. Diese hat ein Wissenschaftlerteam des »CAMP« mit direkter Laser-Interferenz-Musterung (DLIP) funktionalisiert.
Wissenschaftler aus Dresden haben eine selbstreinigende Oberfläche entwickelt. Ein Projektteam der Technischen Universität Dresden und des Fraunhofer-Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik IWS strukturierte eine Aluminiumplatte mit einem Laserverfahren so, dass Wassertropfen über die Oberfläche rollen können und dadurch Schmutzpartikel entfernt werden – ganz ohne chemische Reinigungsmittel oder zusätzliche Kräfte. Weiterlesen

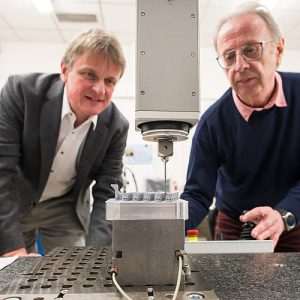



![Bild 1: Einfluss des Nanofüllstoffanteils auf den E-Modul und die Zugfestigkeit im Vergleich zum ungefüllten PP [10]](https://werkstoffzeitschrift.de/wp-content/uploads/2020/05/Bild1-300x111.png)