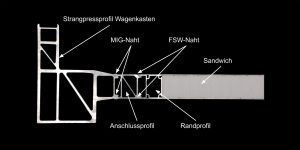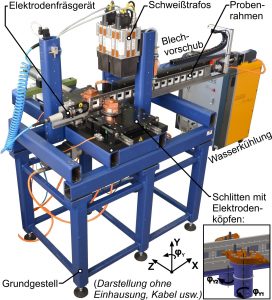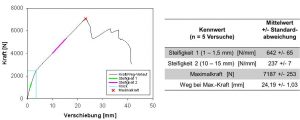Solarmodule mit Drucktechniken fertigen – das könnte bei der Energiewende das Tempo erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Möglich wird das mithilfe eines leitfähigen und druckbaren Klebstoffs, den Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und das Unternehmen PROTAVIC INTERNATIONAL in einem gemeinsamen Projekt zur Marktreife bringen. Beim Innovationswettbewerb NEULAND haben sie nun den Transferpreis gewonnen.
Der Spezialkleber soll die Herstellung von Photovoltaik-Modulen stark vereinfachen und dabei den Energie- und Materialverbrauch senken. „Dank der neuen Klebetechnologie werden Lötverbindungen überflüssig“, erklärt Professor Norbert Willenbacher das neue Verfahren, das er mit seinem Team am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM) des KIT entwickelt hat. Weiterlesen