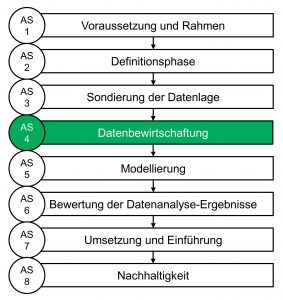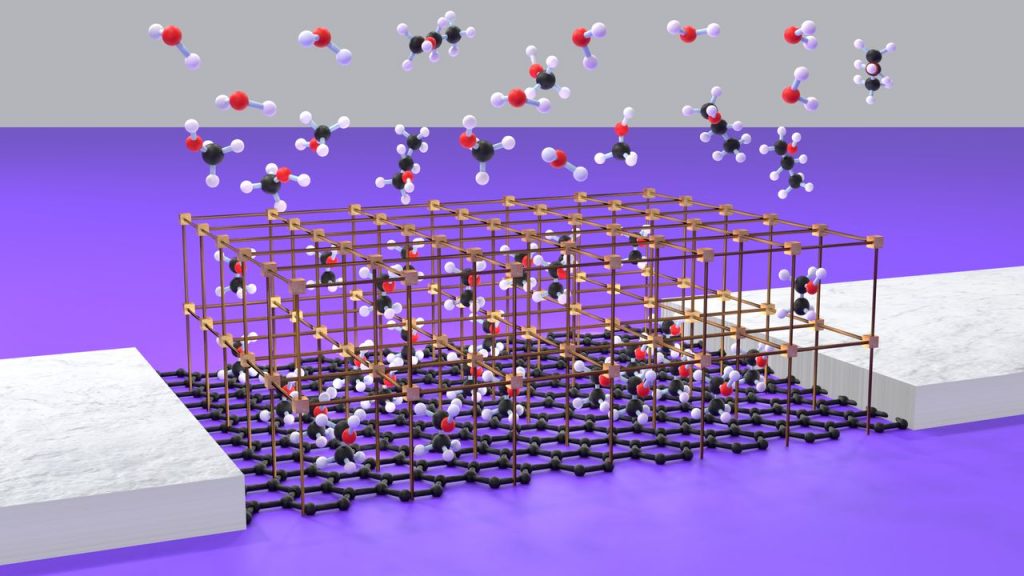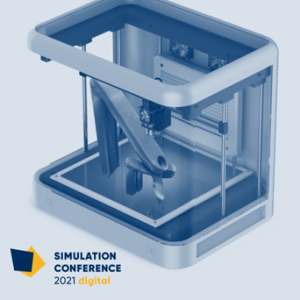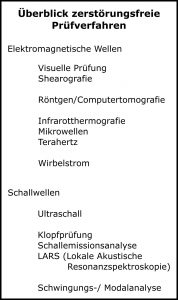Wartungsplaner verwaltet die wiederkehrenden Prüftermine
Es ist nicht immer leicht, den Überblick über Prüfvorschriften und Prüffristen zu bewahren. Egal, ob Geschäftsführer, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsfachkraft: Von einem Wartungsplaner als Arbeitsschutzsoftware profitieren fast alle Bereiche in einem Unternehmen.
Mit der Software Wartungsplaner können Unternehmen sämtliche prüfungspflichtige Gegenstände leicht und schnell verwalten. Weiterlesen